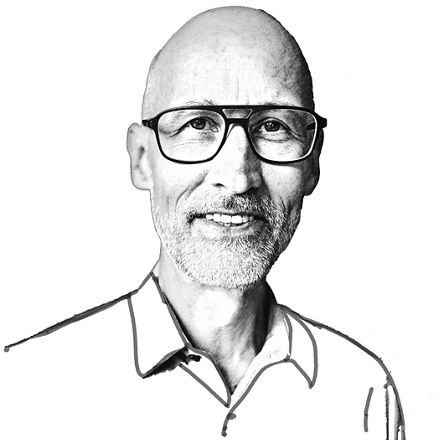Herr Wuttke, Sie sind Europäer, haben mehr als 30 Jahre in China verbracht und leben seit einem Jahr in den USA. Welche Region ist aus Ihrer Sicht für das globale Innovationsgeschehen gerade maßgeblich?
China spielt hier eine große Rolle. Die Kunden sind dort extrem anspruchsvoll und wollen stets sofort das Neueste haben. Nehmen Sie zum Beispiel die Mobilität: In Deutschland stellen wir Autos her, in China produzieren sie Mobiltelefone auf Rädern. Sich darauf einzustellen, gibt einen Wahnsinnsdruck auf die gesamte Lieferkette – auch auf die Chemiebranche, für die China etwa die Hälfte des Weltmarkts ausmacht.

Wie gelingt es China, diese Menge an Innovationen hervorzubringen?
Indem das Land Talente produziert wie kein zweites: Man hat dort einen riesigen Pool an Leuten, die Entwicklungen vorantreiben, und eine große Zahl an Top-Unis für Ingenieurwesen und Chemie. Zugleich fördert die Regierung in Peking in großem Stil strategisch wichtige Branchen: Elektrofahrzeuge, Windturbinen, Batterien, Solar und so weiter. Es gibt Geld und die klare Ansage, bestimmte Branchen an die Weltspitze zu führen. In Europa, insbesondere in Deutschland, haben wir zu viel „on and off“ – wie etwa beim Gebäudeenergiegesetz –, was planvolle Innovationen schwierig macht.
In vielen Branchen, von der Solarenergie bis zur Batterietechnologie, haben chinesische Unternehmen europäische abgehängt – obwohl die zugrunde liegenden Erfindungen gar nicht dort gemacht wurden. Woran liegt das?
Der messerscharfe Wettbewerb in der chinesischen Wirtschaft führt dazu, dass Unternehmen dort selten Grundlagen erforschen. Es geht ihnen eher darum, aus einer bestehenden Idee heraus ein Produkt zu entwickeln. Die Chinesen sind supergut darin, Technologien schneller, besser und billiger auf den Markt zu bringen als deren Erfinder. Sie haben die Batterie nicht erdacht, das waren Koreaner und Japaner. Aber sie haben es am besten verstanden, das Produkt für den Bedarf der Anwender weiterzuentwickeln und zu vermarkten.

Also genau das, was europäischen Firmen mitunter schwerfällt.
Genau. Wobei sich europäische Unternehmen, die in China aktiv sind, leichtertun. Das Land ähnelt einem Fitnesscenter. Die Leute in den Laboren europäischer Firmen in Schanghai, Chengdu oder Nanjing wissen, dass sie schnell sein müssen, um mit den einheimischen Wettbewerbern mitzuhalten. Zugleich überträgt sich die Risikobereitschaft der Kunden auf die Entwickler. Damit die Hose nicht rutscht, braucht man nicht immer eine Lösung mit Gürtel und Hosenträgern. Man muss mit einer Entwicklung auch mal raus auf den Markt.
Peking reglementiert den Zutritt zu diesem Fitnesscenter jedoch immer stärker. Importe aus Europa nach China sinken – ebenso wie Direktinvestitionen. Wie wird sich das auf das Innovationsgeschehen auswirken?
Die Zahlen gehen tatsächlich runter – zumindest wenn es um Produkte aus der „Sunset Industry“ geht, etwa Autos mit Verbrennungsmotoren. Zugleich strebt das Land nach mehr Autarkie, zum Beispiel in der Medizin. Diese Bestrebungen sind eine riesengroße Herausforderung. Ausländische Firmen, die in China für China arbeiten, können weiterhin von den Clustern im Land profitieren. Wichtig ist, dass sie ihre dort gewonnenen Erkenntnisse auch anderswo umsetzen. Noch sind die Silowände in manchen Unternehmen sehr solide.

»Wir haben in Europa keine Regierung, die etwa den Batteriemarkt pusht«
Jörg Wuttke DGA-Albright Stonebridge Group
Bei aller Bewunderung für den chinesischen Innovationsgeist: Ein autokratisches System, das vieles lenken kann, bringt doch auch Probleme mit sich.
Ja. Korruption, Nepotismus und Geldverschwendung sind an der Tagesordnung. Von 140 Automobilmarken in China machen maximal 20 Gewinn. Obwohl jede Menge Geld in das System gesteckt wird, kommen am Ende doch nur wenige Champions heraus. Aber die haben es in sich, denken Sie nur an die KI-Firma DeepSeek.
Was können sich pluralistische Systeme von den Chinesen abschauen?
Wir haben in Europa keine Regierung, die etwa den Batteriemarkt pusht, indem sie selbst für die nötige Nachfrage sorgt. Wir machen das eher über Regularien. Das kostet Geschwindigkeit. Einmal ist es uns jedoch schon gelungen, durch geschickte Industriepolitik das Geld für ein Produkt bereitzustellen, das heute weltweit marktführend ist.
Sie sprechen vom Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus?
Richtig. Der Staat sollte sich zwar bei marktwirtschaftlichen Mechanismen zurückhalten und grundsätzlich eher deregulieren. Aber manchmal sind Komplexität und Risiko so groß, dass der Staat unterstützen muss.

Welche Branche hat für Sie noch eine solch strategische Bedeutung ?
Zum Beispiel Rüstung. Über Entwicklungen auf diesem Gebiet könnten europäische Unternehmen in Hightechbereiche vorstoßen, die auch auf andere Wirtschaftszweige abstrahlen, etwa die Entwicklung von Drohnen für den zivilen Einsatz oder leistungsfähigen Legierungen. Ähnlich wie bei der US-Weltraumbehörde Nasa, durch deren Entwicklungen auch Produkte wie Teflon oder das Internet herauskamen. Auch die Biotechnologie ist ein Feld, das Europa besetzen kann. Dort sind wir schon heute wirklich gut und die Chinesen vergleichsweise schwach.
2024 ist der frühere EZB-Chef Mario Draghi im Auftrag der EU-Kommission der Frage nachgegangen, warum Europa beim Thema Innovation ins Hintertreffen gerät. In seinem Bericht macht er unter anderem den Vorschlag, die staatlichen Ausgaben für Forschung um 200 Milliarden Euro zu erhöhen. Würde das helfen?
Die Erfolgsformel heißt „Brain meets money meets market“. Wir brauchen die richtigen Leute, um Innovationen voranzutreiben. Unser Bildungssystem muss mehr Begeisterung für Naturwissenschaften wecken – gerade in Deutschland. Das fängt schon im Kindergarten an. Das zweite ist die Digitalisierung. Ich habe meine Kinder 2020 aus der deutschen Schule in Peking genommen, wo man immer noch stark auf Bücher und Papier setzte. Sie wechselten zur amerikanischen Schule, wo alles auf Tablets stattfand und die Schüler sogar Roboter bauten. Auch deshalb sind wir 2024 nach Amerika gezogen, nicht nach Deutschland.

Dass sich der neue US-Präsident nun so vehement gegen eine offene Gesellschaft stellt und auf der Wissenschaft herumtrampelt, ist natürlich ironisch. Ich werde hier immer mehr zum Chinesen.
Bis Chemiekästen in Kitas und Tablets in Schulen Wirkung zeigen, werden viele Jahre vergehen. So viel Zeit haben wir wohl kaum.
Stimmt. Deshalb sollten wir jetzt Topleute aus dem Ausland holen. Für Europa ergibt sich dafür gerade eine gute Gelegenheit: zum einen wegen der überpolitisierten Landschaft in China, zum anderen wegen der Verwerfungen zwischen Peking und Washington. Die Sterne stehen gar nicht so schlecht für Europa.
Wie können wir diese Leute nach Europa locken?
Wir müssen zeigen, dass wir für hoch qualifizierte Fachleute attraktiv sind. Die Regierungen müssen mitziehen und Vorschriften für ausländische Arbeitnehmer abspecken. Natürlich muss gewährleistet sein, dass wir niemanden einladen, der nur Wissen absaugt. Wir könnten über europäische Firmen in China sehr leicht Leute identifizieren, die wir herbringen möchten. Auch deshalb sollten wir uns von dort nicht zurückziehen – selbst wenn der Markt kleiner wird.
"Die Leute kriegen mit, dass Parteien wie die AfD an Rückhalt gewinnen – und ziehen ihre Schlüsse daraus"
Wie mobilisieren wir mehr Risikokapital? Ohne Venture Capital gäbe es das Silicon Valley nicht. Und in China stammen immerhin 80 Prozent der Forschungsgelder aus dem Privatsektor.
Die Risikofreude aufseiten der Geldgeber wird in den kommenden Jahren von enormer Bedeutung sein, um Ausgaben für Forschung und Entwicklung zu stemmen und den Rückstand zu China zu verringern. Viele Risikokapitalgeber, mit denen ich es in Peking zu tun hatte, verlassen das Land wegen der wachsenden Unsicherheit in der Wirtschaft. Die gehen nach Tokio, Abu Dhabi oder Singapur. Für Deutschland konnte ich keinen begeistern. Das liegt an der Sprache. Die Leute kriegen aber auch mit, dass Parteien wie die AfD an Rückhalt gewinnen – und ziehen ihre Schlüsse daraus.

Wir müssen es also aus eigener Kraft schaffen?
Vor allem müssen wir die Fragmentierung des europäischen Risikokapitalmarkts überwinden. Es gibt keinen einheitlichen Rechtsrahmen, was Investitionen und das Fundraising über Grenzen hinweg behindert.
Wir haben viel darüber gesprochen, was Europa von China lernen kann. Können Sie uns auch Lektionen aus Ihrer neuen Heimat Amerika mitgeben?
Amerikas große Stärke war immer der Kapitalmarkt: die Wall Street und das Venture-Capital-System. So wurden Leute gefördert, die aus Garagen heraus Unicorns hervorgebracht haben. Darauf lohnt es sich einen Blick zu werfen. Außerdem konnten die USA lange Zeit die besten Köpfe der Welt anziehen. Dass dies gerade unterbunden wird, ist schwer nachzuvollziehen – und sicher nichts, was wir uns zum Vorbild nehmen sollten.
Sie leben seit den Neunzigerjahren im Ausland. Was müsste passieren, damit Sie nach Europa zurückkehren?
Seit Jahresanfang hat sich die Stimmung in den USA total verändert. Meine Kollegen fragen sich immer häufiger: Was kann ich posten? Was wird kritisch gesehen? Meine Frau hat einen russischen Pass. Und obwohl sie ein gültiges Visum hat, hoffen wir, dass sie nach unserem Urlaub in Deutschland ohne Probleme wieder einreisen kann. Zunächst einmal muss unser Jüngster hier die Schule beenden. Dann sehen wir weiter.
ELEMENTS-Newsletter
Erhalten Sie spannende Einblicke in die Forschung von Evonik und deren gesellschaftliche Relevanz - ganz bequem per E-Mail.