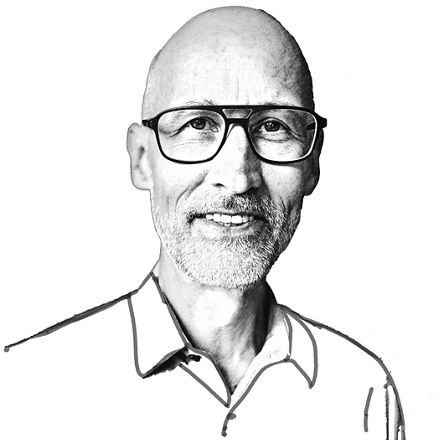Herr Professor Fichtner, als „Batteriepapst“ fahren Sie selbstverständlich ein Elektroauto. Wie zufrieden sind Sie?
Wir nutzen in Ulm am Institut ein elektrisches Auto, mit dem ich etwa zu Vorträgen nach München fahre. Das klappt gut. Die Ladegeschwindigkeit ist mir etwas zu niedrig, aber ich lade meist hier im Institut, wo es darauf nicht ankommt. Kollegen fahren damit aber auch schon mal auf eine Konferenz in Triest.

Geringe Reichweite, lange Ladedauer, hoher Preis – bisher gab es viele Gründe gegen Elektroautos. Können Sie den Skeptikern Hoffnung machen, dass die Batterietechnik Fortschritte macht?
Die nächste Generation Batterien, die jetzt schon vor allem in Asien in Fahrzeugen verbaut ist, kann mit 6C geladen werden. Das heißt: In achteinhalb Minuten ist die Batterie von 10 auf 80 Prozent geladen. Dafür reicht schon eine 350-Kilowatt-Säule.
ELEMENTS-Newsletter
Erhalten Sie spannende Einblicke in die Forschung von Evonik und deren gesellschaftliche Relevanz - ganz bequem per E-Mail.
Sie sprechen von Batterien auf Lithium-Ionen-Basis mit flüssigem Elektrolyten. Ist diese Technik nicht ausgereizt?
Da tut sich schon noch etwas. Aber wir stehen uns gerade in Deutschland mit unserem Ingenieursansatz im Weg. In Europa setzen wir auf lauter kleine Batteriezellen, die wir dann in einem Modul zusammenstecken. Dann verbinden wir mehrere Module auf engem Raum, und fertig ist der kompakte Batteriepack. Das ist unglaublich kleinteilig, es gibt jede Menge Verpackung, Kabel und Gehäuse, und der Gehalt an eigentlichem Speichermaterial ist vergleichsweise gering. Das ist auch der Grund dafür, dass man in Europa fast ausschließlich auf Akkus mit dem hochleistungsfähigen NMC-Material setzen muss, also Batterien auf Basis von Nickel, Mangan und Kobalt. Das ist in China anders.
Inwiefern?
Dort wird das Innere der Batterie in einem Akkupack viel großzügiger gestaltet. Größere Zellen mit mehr Raum für das Speichermaterial erlauben den Einsatz von günstigerem Material, etwa Lithiumeisenphosphat, das im Pluspol der Batterie angesiedelt ist, der Kathode. Lithiumeisenphosphat hat eine niedrige Dichte und ist recht voluminös. Den Platz dafür hat man aber in diesen Batteriepacks. In China kommen jetzt die ersten Fahrzeugmodelle mit Eisenphosphat-Batterien auf den Markt. Die haben 1.000 Kilometer Reichweite und können in zehn Minuten geladen werden.
Beeindruckend! Aber sind diese Autos wirklich umweltverträglicher? Eine Studie des Vereins Deutscher Ingenieure kommt zu dem Ergebnis, dass ein E‑Auto – je nach Art des Stroms für Herstellung und Betrieb – einem Verbrenner erst nach 60.000 bis 90.000 Kilometer ökologisch überlegen ist.
Das ist bloß eine aktuelle Studie mit einigen fragwürdigen Grundannahmen. Institutionen wie der International Council on Clean Transportation oder das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe machen solche Lebenszyklusanalysen schon sehr lange und kommen auf andere Ergebnisse.
Deren Analysen besagen, dass der Break-even beim CO2 je nach Batterie und Strommix bereits nach 20.000 bis 40.000 Kilometern erreicht ist. Tesla nutzt in seiner Factory in Texas fast zu 100 Prozent erneuerbare Energien – da ist der CO2-Fußabdruck schon nach 8.000 bis 9.000 Kilometer besser als der eines Verbrenners.

Bleibt das Thema Sicherheit. Immer wieder gibt es spektakuläre Fälle von Batteriebränden.
Auch dazu gibt es jetzt Daten. In den USA hat man die Zahlen von Versicherern und der dortigen Verkehrswacht zusammengetragen. Pro Milliarde gefahrener Kilometer gab es 96 Brände bei Verbrennern und drei bis vier bei Elektrofahrzeugen. Demnach brennen Verbrennerfahrzeuge also 25-mal so oft wie Elektroautos. Schwedische Zahlen zeigen ein ähnliches Verhältnis. Eine vermeintlich höhere Brandgefahr kann also wirklich kein Argument gegen E‑Mobilität sein.
Wann wird Batterietechnik im Vergleich zu Verbrennungsmotoren wettbewerbsfähig sein?
Technisch ist sie bereits gleichwertig, jetzt geht es vor allem um die Kosten. Vergleicht man die preislich dominierenden Teile Motor und Batterie, ist man aber auch hier auf Augenhöhe. Ein Beispiel: Eine Kilowattstunde Batteriekapazität kostet in der Herstellung derzeit rund 90 US-$. Bei einer Batterie mit 70 Kilowattstunden bin ich also bei Fertigungskosten von 6.300 US-$. Mein alter Alfa Romeo Spider, ein Spaßauto für den Sommer, brauchte vor ein paar Jahren mal einen neuen Motor – der hat mich 8.000 € gekostet. Batterien sind also nicht mehr teurer als Benzin- oder Dieselaggregate. In China sind bereits zwei Drittel aller Elektroautos günstiger als die entsprechenden Verbrenner. Dort gibt es schon Modelle für umgerechnet 10.000 €. Noch günstiger wird es perspektivisch mit Technologien wie der Natriumionen-Batterie. Die ersten Autos fahren damit schon in China herum – Stadtflitzer mit 300 Kilometer Reichweite.

»Technisch ist die Batterietechnologie bereits mit dem Verbrennungsmotor gleichwertig. Jetzt geht es vor allem um die Kosten.«
Maximilian Fichtner Direktor am Helmholtz-Institut Ulm für Elektrochemische Energiespeicherung
Warum sind E‑Fahrzeuge in Europa so viel teurer?
China hat nun mal ganz klar einen Vorlauf. Was jetzt bei Northvolt passiert ist …
... der schwedische Batteriefertiger ist wegen Qualitätsproblemen in die Insolvenz gerutscht ...
... das hat man in China ja auch erlebt. 20 bis 30 Prozent der Zellen haben zu Beginn fast jeder Serienfertigung Fehler. Während bei uns die Zeitpläne diesen Umstand aber kaum berücksichtigt haben und Northvolt wegen zu optimistischer Versprechen in Schieflage geraten ist, hat man in China Geduld bewiesen, ist am Ball geblieben und hat einfach weitergemacht. Fünf Jahre lang hat man all die kleinen Schräubchen in der Fertigung eingestellt – und kam am Ende mit einem praktisch perfekten Ergebnis raus. Heute sind die Chinesen Weltmarktführer.
Es mangelt uns also hierzulande an Geduld?
Ja. Batteriezellenfertigung ist ein hochkomplexes Thema. Wenn wir zu schnell die Geduld verlieren und Investoren zusätzlich dadurch verunsichern, dass wir immer wieder diskutieren, womöglich doch beim Verbrennungsmotor zu bleiben, dann werden wir das nicht schaffen. Wir haben uns in Europa etwas Zeit gekauft durch Zölle auf chinesische Elektrofahrzeuge. Aber wenn die Zeit nicht genutzt wird, sehe ich wirklich schwarz.
Es geht auch um eine Menge Geld. In den USA wurden – zumindest unter der Präsidentschaft von Joe Biden – Abermilliarden in den Ausbau der Elektromobilität gesteckt. Benötigen wir in Europa mehr Subventionen, um den Anschluss nicht zu verpassen?
Im Rahmen des Inflation Reduction Act hat die amerikanische Regierung 650 Milliarden US-$ bereitgestellt, um Firmen aus dem grünen Sektor – und dazu gehören auch Batteriefirmen – zu unterstützen. In China haben die Firmen über Jahre hinweg ebenfalls Unterstützung bekommen. Bei uns zu Lande wird das dagegen als staatlicher Dirigismus und Planwirtschaft ge-geißelt. Ein weiterer Punkt: Anders als in Deutschland reinvestieren die chinesischen Batterie- und Autohersteller ihre Gewinne fast vollständig. So haben sie sich einen Vorsprung erarbeitet und konnten riesige Entwicklungsabteilungen aufbauen. Auch Samsung und LG in Südkorea haben es so an die Spitze geschafft. Man muss bereit sein, ein unternehmerisches Risiko einzugehen.
Das sagt sich leicht dahin. Hierzulande haben Unternehmen mit Batterieprojekten viel Lehrgeld bezahlt – auch Evonik in dem Joint-Venture Litec, aus dem das Unternehmen 2014 ausgestiegen ist. Die Geduld der Aktionäre mit Verlustbringern ist endlich.
Und genau mit der Einstellung müssen wir irgendwann alles, was eine längere Entwicklungszeit erfordert, aus dem Ausland zukaufen.
Sie konzentrieren sich auf die Entwicklung von Feststoffbatterien. Welchen Vorteil bietet die Technologie gegenüber Akkus mit flüssigem Elektrolyten?
Die potenzielle Speicherkapazität ist deutlich höher – um 30 bis 40 Prozent. Man käme also in die Gegend von 350 bis 400 Wattstunden pro Kilogramm Speichermaterial. Bei gleicher Reichweite würde die Batterie entsprechend leichter.

Wo setzt die Forschung an, um diesen Prozess voranzutreiben?
Im Moment wird viel an anodenlosen oder „Zero Excess“-Zellen gearbeitet. Bisher besteht die Anode, also der Minuspol, aus Graphit. Jetzt hat man entdeckt, dass die Zelle auch funktioniert, wenn man den Graphit weglässt. Wandert Lithium durch einen Festelektrolyten, scheidet es sich anstatt im Graphit direkt auf der Kollektorfolie ab und bildet eine Metallschicht. Dadurch spart man eine Menge Volumen und Masse. Die Laborzellen, die jetzt in Kanada und China gefertigt wurden, speichern um die 700 Wattstunden pro Kilogramm. Das wäre also mehr als eine Verdopplung der aktuellen Kapazität. Ein Fahrzeug käme damit 1.900 Kilometer weit, oder ein Batteriepack für die bisherige Reichweite wäre nur noch halb so schwer.
Aber vermutlich auch deutlich teurer. Sprechen wir hier über eine Spitzentechnologie für Oberklassefahrzeuge und Sportwagen?
Es gibt es einen ganzen Zoo von Konzepten. Meist enthalten Feststoffbatterien eine Keramik, die auf Lanthan-Zirkon oder Phosphor-Schwefel basiert. Eine starre Keramik, die nur ein paar Mikrometer dick ist, und davor ein Speichermaterial, das sich beim Laden ausdehnt und beim Entladen schrumpft, bereitet jedoch Probleme. Die Membran lässt nämlich nur dann Lithium durch, wenn sie in direktem Kontakt mit dem Material steht. Deshalb gibt man häufig ein bisschen Flüssigkeit hinzu, um Lücken zu füllen, oder führt den Elektrolyten als Gel aus.
Daneben gibt es auch noch Lithium-Polymer-Akkus, bei denen Lithium durch ein Polymer hindurchgeht und sich beim Laden auf dem Minuspol absetzt. Solche Batterien haben im französischen Carsharing-System Bluecars 50 Millionen Flottenkilometer eingesammelt.
Warum spielen sie dennoch keine große Rolle?
Für die meisten Alltagsanwendungen haben wir eben schon sehr gute Lösungen, die bezahlbar und vergleichsweise nachhaltig sind. Eisenphosphat etwa ist ein Allerweltsmineral: Wenn Sie Eisensalz in kommunales Abwasser hineinstreuen, bekommen Sie Eisenphosphat als weißes Pulver heraus.

Welche Weltregion sehen Sie derzeit an der Spitze bei der Entwicklung von Batterien der nächsten Generation?
Es ist schwer, die Entwicklung in China zu beurteilen. Aber im Augenblick scheinen die USA die Nase vorn zu haben. Dort arbeiten einfach viele Firmen an dem Thema, und es herrscht eine andere Start-up-Kultur: Dort fragen die Banken nicht, wie sich Geld sparen lässt, sondern wie viel Geld man in welcher Zeit ausgeben kann, um dadurch schneller zum Ziel zu kommen.
Während in China die Mehrzahl der neu zugelassenen Fahrzeuge einen E‑Antrieb haben, sind wir in Europa noch meilenweit davon entfernt. In Deutschland waren zuletzt nicht einmal 14 Prozent der Neuwagen vollelektrisch. Lässt sich das von der Europäischen Union vorgegebene Ziel überhaupt einhalten, dass neu zugelassene Fahrzeuge ab 2035 kein CO2 mehr ausstoßen dürfen?
Der Wegfall der Kaufprämien in einigen Ländern hat jedenfalls viel Schaden angerichtet. In Deutschland kommt hinzu: Wir waren mit dem Verbrenner jahrzehntelang führend und hängen deshalb daran. In anderen Teilen der Welt, die nicht diese Historie haben, wird die Elektromobilität dagegen als tolle Sache empfunden, weil man etwa damit die Städte sauber und leise kriegt. Es entstehen neue Industriezweige, die das Ganze unterstützen, und die Länder sind weniger abhängig von Öl- und Gaslieferungen irgendwelcher Potentaten.
Dennoch werden manche Regionen mangels Infrastruktur oder dank alternativer Kraftstoffe vermutlich länger am Verbrenner hängen – Afrika etwa oder Teile von Südamerika.
Vielleicht kommt es aber auch ganz anders. Ich war gerade in Indien auf einem internationalen Energie- und Mobilitätskongress eingeladen – mit 70.000 Teilnehmern. Dort legt die Elektromobilität, wenngleich auf niedrigem Niveau, rasant zu, und Staat und Industrie formulieren einen Führungsanspruch. Auch in Afrika boomt es in vielen Ecken. Dort setzen sich gerade elektrische Dreiräder durch, bei denen man einfach die Batterie austauscht. Äthiopien hat den Import von Benzin- und Diesel-Neuwagen bereits 2024 untersagt und setzt voll auf E‑Autos, weil dort viel Wasserkraft vorhanden ist – und man weg will von teuren Ölimporten.

Wann wird der letzte Verbrennungsmotor vom Band laufen?
Wenn man die Entwicklung in China extrapoliert, werden dort 2028 nur noch fünf Prozent der Neuzulassungen reine Verbrenner sein. In Europa wird das wohl länger dauern. Ich glaube, dass wir noch eine Weile Plug-in-Hybride haben werden. Darüber läuft das vielleicht langsam aus. Wenn sich die Batterien weiterentwickeln in Richtung kürzere Ladezeiten, höhere Sicherheit, längere Reichweite und bessere Ladeinfrastruktur, wird sich aber jeder irgendwann fragen: Brauche ich mein Benzin- oder Dieselauto überhaupt noch?
Und was wird aus Ihrem Alfa Spider?
Der wird dieses Jahr 25 Jahre alt und ruht sich bis zum Sommer in der Garage aus. Wenn man eine Zeit lang elektrisch gefahren ist, ist es jedoch eine ganz schöne Umstellung, in diesen Rasselbock einzusteigen, den man erst mal auf 3.000 Umdrehungen hochjubeln muss, bis er anfängt, Kraft zu zeigen. Damit werden wir nachfolgende Generationen wenig begeistern können.